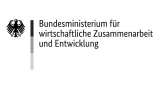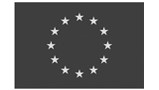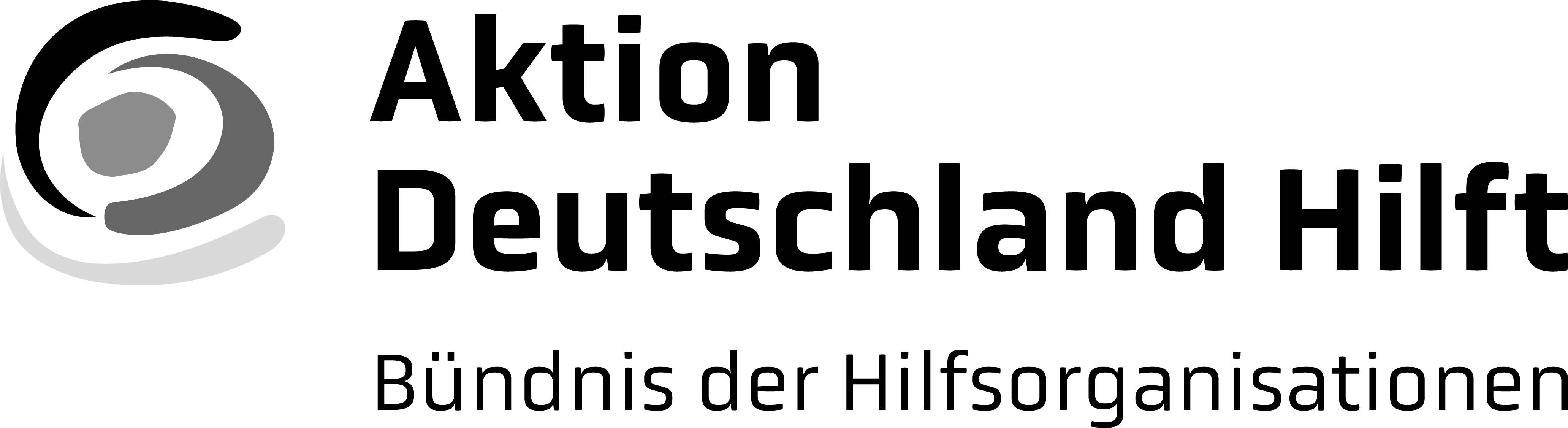Zur humanitären Lage im Ukraine-Krieg | Im Interview mit Pavlo Titko, Leiter der Malteser Ukraine
Pavlo Titko ist Leiter der Malteser Ukraine und seit der Eskalation des Ukraine-Kriegs am 24. Februar 2022 im Dauereinsatz für die vom Krieg betroffenen Menschen im Land. Aus Lviv berichtet er uns von der derzeitigen humanitären Lage in der Ukraine, wie es den Menschen geht, welche Hilfsgüter am dringendsten gebraucht werden und wie er selbst mit dieser Extremsituation umgeht. (Stand: Anfang April 2022)
Wie ist die aktuelle Situation im Westen der Ukraine, wo Sie sich derzeit befinden?
Pavlo Titko: Die Situation verändert sich ständig. Es hängt davon ab, was an der Front passiert. Es kommen mal mehr mal weniger Flüchtlinge und deswegen verändert sich auch unsere Arbeit ständig.
Wie würden Sie die Stimmung vor Ort im Moment beschreiben?
Die Stimmung ist sehr traurig. Man bekommt ständig traurige Nachrichten mit, wie zuletzt die Nachrichten und die Bilder aus Bucha. Das ist ganz nah an Kyiv. Da gab es bei uns viele Bekannte und Verwandte, die nicht weit von diesem Ort gelebt haben und jetzt auf der Flucht sind. Sie sind schon vorher geflohen und nicht vor Ort geblieben. Sonst wären sie jetzt nicht mehr am Leben.

Kommen derzeit immer noch mehr Flüchtlinge nach Lviv oder gibt es da gerade einen Stillstand?
Gerade kommen weniger, aber dennoch ständig neue Flüchtlinge am Bahnhof an. Das erleben wir, wenn wir das Essen verteilen. Die Zahl der Portionen, die wir verteilen, hat sich verändert. Man muss auch sagen, dass mittlerweile zum Bahnhof auch viele Bedürftige kommen, die wissen, dass unsere Küche da steht. Das Klientel hat ein bisschen gewechselt. Es sind nicht nur Flüchtlinge, sondern auch Bedürftige und Obdachlose – die Menschen, die jetzt hiergeblieben sind. Vielleicht sind es die Menschen, die einfach weniger Mut gehabt haben auszureisen. Es sind die Menschen, die in den Notunterkünften geblieben sind, die Menschen, die jetzt in den Schulen sind und die nicht wissen, wie es jetzt weitergeht. Sie wissen nicht, ob sie morgen in Richtung Westen ausreisen, ob sie hier in Lviv einfach noch eine Zeit bleiben oder ob sie eventuell zurückkehren sollen, wenn das in ihrer Heimatregion geht. Man kann sich ausmalen, wie schwer es für sie ist.
Können die Malteser in der Ukraine noch die Menschen im Osten des Landes erreichen mit den Hilfsgütern?
Ja, es ist kompliziert, aber wir bemühen uns sehr, die Ladungen mit Hilfsgütern dorthin zu verschicken, wo es am schlimmsten ist. Das gelingt nicht immer. Mariupol ist komplett zu und wir erreichen dort einfach kaum noch Menschen. Aber in den anderen Gegenden geht es irgendwie. Wir arbeiten sehr viel mit territorialen Gemeinden. Das sind im Grunde genommen wie in Deutschland die Gemeinden von bestimmten Territorien. Die schicken auch ihre Transporter und holen die Sachen ab. Wir versenden die Hilfsgüter in alle Richtungen von Kharkiv im Norden, dann etwas tiefer im Land, bis nach Odessa. Es geht nicht so gut, wie man möchte. Wenn man große LKWs schicken möchte – weil vom Bedarf dies am sinnvollste und auch das effektivste wäre – geht das nicht, aber mit kleineren Transportern funktioniert es.
Wie viele humanitäre Korridore, auf die Sie sich verlassen können, gibt es derzeit tatsächlich?
Wir verlassen uns auf keine humanitären Korridore. Alle Hilfslieferungen gelangen über Umwege in die Ortschaften. Die Menschen kommen von dort, die kennen die Wege und die Russen haben jetzt nicht komplett alles so besetzt, dass man die Blockaden nicht umfahren kann. Das ist jetzt das, was die Menschen rettet, diese Umwege.
Womit können Sie den Menschen derzeit am meisten helfen?
Es sind auf jeden Fall Medikamente und Lebensmittel, würde ich sagen. Das sind die zwei Arten an Hilfsgütern, die wir, aber auch die anderen Hilfsorganisationen und Freiwillige nach Osten versenden. Außerdem braucht es Transportmittel, vor allem Krankenwagen. Wir wissen, dass bis heute 70 zivile Krankenwagen zerschossen wurden und die müssen irgendwie ersetzt werden. Aber auch abgesehen von dem Krieg waren unsere ukrainische RTWs auf einem ganz anderen Standard als in Deutschland und gute gebrauchte RTWs aus Deutschland sind eine große Hilfe für unser Gesundheitssystem.
Wie gehen Sie selbst, aber auch Ihre Kolleginnen und Kollegen mit der permanenten Gefahr bei Ihrer Arbeit um?

Das macht jeder, wie er oder sie kann. Es gibt Menschen, die bei jedem Luftalarm nach unten gehen und sich im Keller verstecken, aber die meisten Mitarbeitenden von uns sind etwas, ich will leichtsinniger sagen. Wenn man sich bei jedem Luftalarm verstecken würde, würde man nicht zur Arbeit kommen. Man nimmt das nicht ganz ernst, obwohl auch die Raketen schon bei uns in der Stadt waren. Es ist sehr abhängig von der persönlichen Einstellung. Das ist bei der Arbeit so und auch zuhause. Die Hälfte von den Menschen in den Wohnungen ist jede Nacht unten, also wir haben keinen Keller, aber eben ein Untergeschoss, und die andere Hälfte schläft, weil sie morgens zur Arbeit müssen. Also es ist sehr unterschiedlich, kann man sagen.
Hat man sich mittlerweile schon ein Stück weit
an diese Situation gewöhnt?
Das ist bei mir oder bei einigen Mitarbeitenden etwas anders. Wir haben schon 2014 angefangen, uns daran zu gewöhnen, natürlich nicht in dem Ausmaß, aber wir haben das schon im Osten erlebt und gesehen. Wir haben diese Angriffe gesehen, haben die Beschüsse erlebt, wir haben die Dienstreisen in Schutzwesten gemacht, wir haben hunderte von Zeugen gehört – durch das Projekt, was wir mit Malteser International seit 2014 machen. Wir kennen viele Geschichten, die während unserer psychologischen Hilfen von den Betroffenen erzählt wurden. Ich habe bei einigen Evaluierungen übersetzen müssen. Wenn man diese Geschichten 20-, 30-mal ausführlich gehört hat, ist man schon ganz anders vorbereitet. In den ersten Interviews, die ich vor einem Monat oder noch sogar vor dem Krieg gegeben habe, habe ich diese Geschichten schon damals als Realität empfunden und ich wusste ungefähr, wie es kommen wird. Leider ist es doch noch viel schlimmer gekommen.
Wenn sie mit den Geflüchteten in Lviv sprechen, haben sie einen Eindruck, wie es ihnen geht?

Wie soll ich das sagen, damit es jetzt nicht so brutal klingt? In den meisten Fällen sind es jetzt keine gesunden Menschen mehr. Sie sind so traumatisiert, sie sind so zerschlagen, sie sind so unsicher, sie wissen einfach nicht, wie es weitergehen soll. Ja, sie wissen nicht, welche Entscheidungen sie morgen treffen sollen. Sie wissen nicht, was ihre Kinder machen sollen, wissen nicht, ob noch mal irgendwann die Schule für die Kinder aufmacht. Sie wissen nicht, wie es dann im Ausland letztendlich aussieht. Sie kennen die Sprache dort nicht. Die meisten aus dem Osten waren nie im Ausland. Das ist einfach nur Stress und Traumatisierung.
Wie kann man diesen Menschen tatsächlich helfen?
Was können Sie ihnen sagen, damit es ihnen besser
geht in dieser Situation?
Das Problem kann man nur richtig angehen, wenn diese Menschen Sicherheit bekommen, also die Sicherheit bekommen, dass sie nicht mehr in dieser Gefahr leben müssen. Dann könnte man mit diesen Menschen eine Therapie machen. Aber mit wie vielen kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie viele Psychologinnen, Psychologen, wie viele Fachleute muss man haben, um alle zu erreichen? Es wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Aber bevor man diese Sicherheit nicht hat, kann man diesen Menschen zeigen, dass man zusammenhält, dass man diesen Menschen helfen will. Mehr kann man wahrscheinlich nicht machen.
Wie schaffen Sie es, sich in dieser Situation täglich aufs Neue zu motivieren?
Man versucht einfach professionell zu bleiben, einfach die Arbeit zu machen. Wir haben sehr große Aufgaben vor uns. Wir sind jetzt prädestiniert durch unsere Lage: Wir sitzen im trockenen, wir sitzen im Westen, wir haben eure Hilfe. Wir können einiges bewegen. Das ist vielleicht unsere Motivation, dass wir einigen Menschen richtig helfen können.
Das Interview wurde Anfang April 2022 geführt.