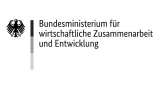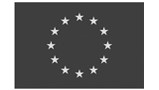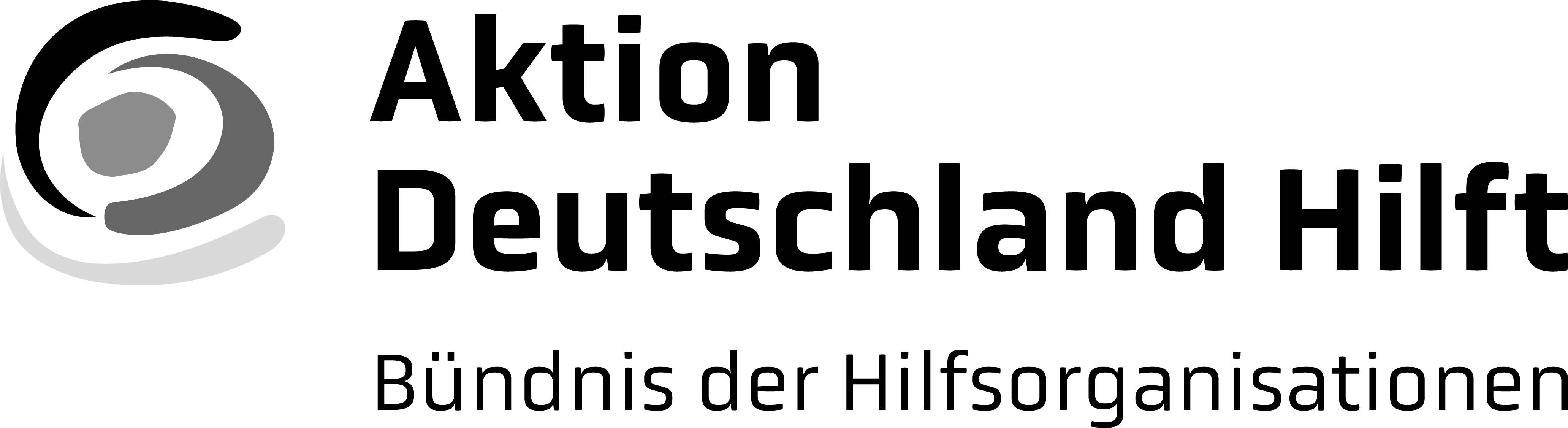Schutz und Sicherheit bei Malteser International
Ob in der Ukraine, im Gazastreifen, im Sudan oder anderen Krisenregionen: Hilfe zu empfangen und zu leisten ist in den vergangenen Jahren zunehmend gefährlicher geworden. Laut Berichten der Vereinten Nationen war 2024 das tödlichste Jahr in der Geschichte der humanitären Hilfe. Und auch im bisherigen Verlauf des Jahres 2025 wurden bereits 265 Helferinnen und Helfer getötet, 115 entführt und zahlreiche weitere verletzt, während sie versuchten, Unterstützung zu Menschen in Not zu bringen.
Wie können wir die Menschen, die wir unterstützen möchten, und unserer Mitarbeitenden schützen? Wir haben zwei unserer Sicherheitsexperten vor Ort zu ihrer wichtigen Arbeit befragt.

Hallo Olexandr, hallo Alison, ihr seid beide verantwortlich für die Sicherheit der Mitarbeitenden von Malteser International und der Menschen, die wir unterstützen, und zwar in der Ukraine und im Südsudan. Was sind die Hauptaufgaben eurer Arbeit?
Alison:
Als Sicherheitsmanager in unserem Malteser-International-Büro im Südsudan entwickle ich unseren landesspezifischen Sicherheitsmanagementplan („Country Safety and Security Management Plan“), standardisierte Arbeitsprozesse („Standard Operating Procedures“) und unsere Sicherheitsregeln. Ich führe Sicherheitsrisikoanalysen durch, koordiniere Sicherheitstrainings wie das HEAT-Training ("Hostile Environment Awareness Training"), sammle und analysiere sicherheitsrelevante Informationen und gebe zeitnahe, verlässliche und glaubwürdige Sicherheitshinweise, damit unsere Mitarbeitenden auch in komplexen und risikoreichen Umfeldern sicher arbeiten können.
Olexandr:
Kurz gesagt, besteht meine Aufgabe als Sicherheitsberater darin, unsere Mitarbeitenden während ihrer wichtigen Arbeit in einem dynamischen Umfeld inmitten eines anhaltenden bewaffneten Konflikts zu schützen, physisch wie mental. Mein Ziel ist es, dass unsere Teams die Menschen in Not ohne unnötige Risiken erreichen können. Meine Rolle verbindet also operative Sicherheit mit organisatorischer Verantwortung – zum Schutz unserer Mitarbeitenden und zur erfolgreichen Umsetzung unserer Mission.
Zusätzlich zu den Aufgaben, die Alison bereits erwähnt hat, koordiniere ich den sicheren Zugang und die Bewegungen unserer Teams und reagiere auf Vorfälle und Notfälle. Ich gebe strategische und operative Sicherheitsempfehlungen und regelmäßige Sicherheitsbriefings und organisiere Trainings. All das fördert auch das Risikobewusstsein und die Resilienz unserer Mitarbeitenden. Dabei arbeite ich eng mit lokalen Behörden – sowohl zivilen als auch militärischen –, UN-Organisationen und unseren NGO-Partnern in der Ukraine zusammen. Letztlich sorgt meine Arbeit dafür, dass durch Spenden finanzierte Programme sicher, verantwortungsvoll und im Einklang mit dem Fürsorgeprinzip von Malteser International und den humanitären Grundsätzen umgesetzt werden.

Wie bereitet ihr nationale und internationale Mitarbeitende mental und physisch auf Einsätze in Hochrisikogebieten vor – zum Beispiel in aktiven Kriegszonen?
Alison:
Für nationale und internationale Mitarbeitende führen wir vor einem Einsatz zeitnahe, kontextbezogene Sicherheitsbriefings durch. Wir bieten grundlegende Sicherheits- und Schutzschulungen sowohl intern als auch über spezialisierte Partner an. Zudem geben wir tägliche bis wöchentliche Sicherheitsupdates – das ist wichtig, um das Bewusstsein für die Risikolage aufrecht zu erhalten. Für internationale Mitarbeitende führen wir vor dem Einsatz spezielle Briefings durch. Im Südsudan haben wir außerdem ein Programm für mentale Gesundheit, um die Stressresistenz und Resilienz unserer Teams zu stärken.
Bei Malteser International Südsudan legen wir großen Wert auf starke Akzeptanzstrategien, regelmäßige Sicherheitsbriefings, strikte Einhaltung der Standardarbeitsanweisungen, sorgfältige Notfallplanung und kontinuierliche Abstimmung mit internen Sicherheitsansprechpersonen sowie externen Sicherheitsnetzwerken von UN und NGOs.
Olexandr:
In der Ukraine arbeiten alle Mitarbeitenden – nationale wie internationale – unter ständiger Bedrohung. Je weiter man in den Osten geht, desto höher sind die Risiken. Aber selbst Kyiv, die Hauptstadt, wird regelmäßig durch schwere Raketen- und Drohnenangriffe getroffen. Die Realität ist: Es gibt keinen vollständig sicheren Ort mehr im Land. Selbstschutz ist daher für uns kein abstraktes Konzept, sondern tägliche Praxis für humanitäre Helferinnen und Helfer.
Die Vorbereitung auf Einsätze in Hochrisikogebieten ist ein zentraler Bestandteil meiner Arbeit als Sicherheitsberater. Unsere Strategie in der Ukraine kombiniert psychologische Vorbereitung, praktische Fähigkeiten und klare Abläufe, damit unsere Mitarbeitenden informiert, selbstbewusst und widerstandsfähig sind – und ihre Arbeit effektiv und sicher ausführen können. Dazu gehören realistische Briefings, Werkzeuge zum Stressmanagement und Peer-Support. Für internationale Mitarbeitende bieten wir vor dem Einsatz kulturelle und situationsbezogene Orientierung. Und natürlich gibt es verpflichtende Sicherheits- und Schutztrainings wie HEAT sowie regelmäßige Übungen und Simulationen. Ich versorge die Teams täglich mit Sicherheitsupdates. Während der Einsätze werden alle Mitarbeitenden live getrackt und müssen sich regelmäßig zurückmelden.

Wie stellen wir sicher, dass die Menschen, die wir unterstützen, auch in risikoreichen Kontexten geschützt sind – insbesondere bei der Verteilung von Hilfsgütern?
Alison:
Im Südsudan arbeiten wir dafür eng mit lokalen Gemeinschaften und Behörden zusammen. Vor und während einer Mission bewerten wir kontinuierlich die sich verändernden Sicherheitsrisiken und passen unsere Strategien zur Hilfeleistung entsprechend an. So versuchen wir, die Gefährdung der Menschen zu minimieren und ihre Würde sowie ihr Wohlergehen zu schützen.
Olexandr:
Gerade im Osten der Ukraine, wo Orte an der Frontlinie regelmäßig beschossen werden und Drohnen häufig zivile Bewegungen überwachen, ist die Organisation sicherer, würdevoller und konflikt-sensibler Hilfsgüterverteilungen eine Frage von Leben und Tod. Um die Sicherheit zu gewährleisten, führen wir beispielsweise keine Verteilungen in offenen, gut sichtbaren oder dicht besiedelten öffentlichen Bereichen durch, die potenziell zu Zielen werden könnten. Wir stimmen unsere Aktivitäten eng mit lokalen Behörden und Gemeindevorstehern ab, um den sichersten Zeitpunkt und Ort zu bestimmen. Häufig nutzen wir mobile Ausgabepunkte oder Tür-zu-Tür-Verteilungen. Wenn wir von einem zentralen Punkt aus verteilen müssen (z. B. von einem LKW), halten wir die Aktion möglichst unauffällig, kurz und geordnet – und tun alles, um lange Warteschlangen zu vermeiden.
Ein weiterer sehr wichtiger Punkt: Wir achten darauf, dass die Verteilung von Hilfsgütern keine sozialen Spannungen oder Missgunst auslöst. Dafür achten wir zum Beispiel auf klare Kommunikation, gerechten Zugang und die Vermeidung jeglicher Form von Bevorzugung.
Durch diese und viele weitere Maßnahmen sorgen wir dafür, dass die Hilfeleistung niemals ein Risiko für die Menschen wird, die wir unterstützen wollen. Denn niemand sollte zwischen Sicherheit und Hilfe wählen müssen.
August 2025