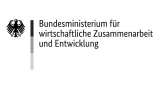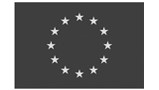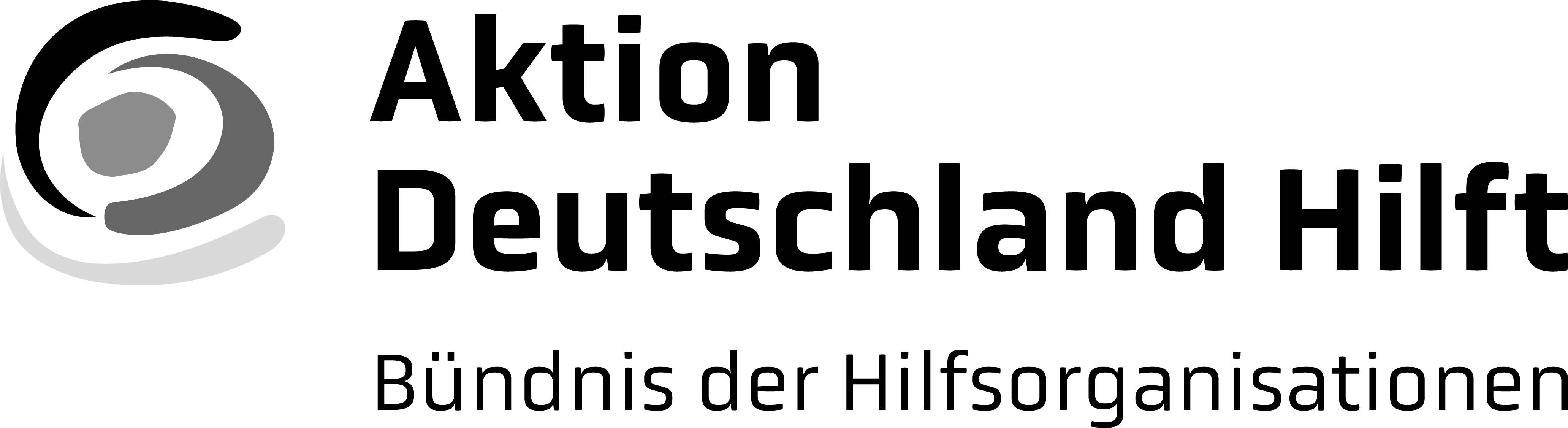Seit 2015 bieten Malteser International und sein Netzwerk lokaler Partner, darunter auch Malteser Ukraine, über spezielle Zentren (derzeit in Lemberg, Kiew, Sumy, Dnipro, Charkiw und Mykolaiw), mobile Teams und telemedizinische Plattformen Dienste für psychische Gesundheit und psychosoziale Unterstützung an.
Kinder, die durch die Auswirkungen von Konflikten und Vertreibung besonders gefährdet sind, erhalten gezielte Unterstützung durch Sommercamps und Spielmobile - speziell ausgestattete Busse, die auf die Bedürfnisse von Kindern zugeschnitten sind. Teams aus Psychologen und Sozialarbeitern führen altersgerechte, kindgerechte Aktivitäten in Schulen und anderen sozialen Einrichtungen durch.
Seit 2022 umfasst unsere Nothilfe auch die Verteilung von Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Winterpaketen an schwer zugängliche Gebiete in der Ost- und Südukraine, was durch ein gut ausgebautes Logistiknetz im ganzen Land ermöglicht wird. Das internationale Netzwerk des Malteserordens steht an der Seite der vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen und wird dies auch weiterhin tun, solange Hilfe benötigt wird. Wir setzen uns dafür ein, Hilfe zu leisten, die der dynamischen Situation und Bedürfnissen vor Ort angepasst ist.
Der Krieg in der Ukraine dauert an. Millionen Menschen sind weiter auf Hilfe angewiesen und werden es für Jahrzehnte sein. Wir unterstützen die Menschen in der Ukraine mit unterschiedlichen Hilfsmaßnahmen. Dabei arbeiten wir eng mit dem Team von Malteser Ukraine und weiteren Partnern zusammen, die die Bedarfe der Menschen vor Ort abfragen und die Hilfen umsetzen.
Unser Programm konzentriert sich auf lebensrettende Maßnahmen und die Bereitstellung von Hilfsgütern in den vom Krieg betroffenen Gebieten in der Ost- und Südukraine. Wir bieten psychosoziale Unterstützung für Menschen, die während des Krieges mentale Gesundheitsprobleme hatten. Wir führen umfassende Initiativen zur Kinderbetreuung durch und unterstützen ukrainische Geflüchtete in den Nachbarländern.
18.11.2024 Köln/Lwiw. Der dritte Kriegswinter in der Ukraine droht besonders hart zu werden. Die Temperaturen sind bereits deutlich gesunken. Viele Häuser haben nach bald drei Jahren Krieg keine funktionierenden Heizungen mehr und die Fenster zerstört sind. Das Stromnetz ist heftigen Angriffen ausgesetzt. Lisa Schönmeier, Leiterin der Ukraineabteilung von Malteser International, sagt: „In den vergangenen Tagen haben die Angriffe deutlich zugenommen. Wichtig ist es zu Beginn des Winters, die Menschen im Hinblick auf die weiter sinkenden Temperaturen zu unterstützen vorzubereiten."
Weiterlesen